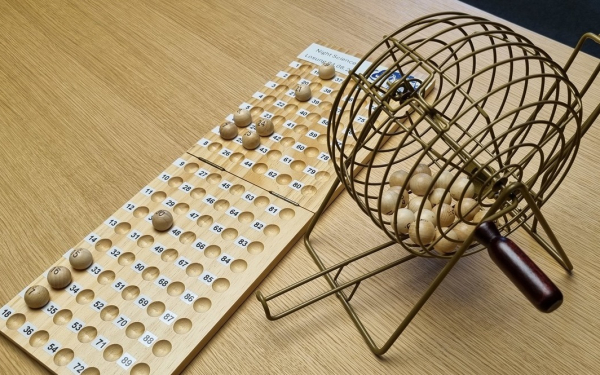"Grundlagenforschung ist Teil der DNA unseres Förderhandelns"

VolkswagenStiftung
Henrike Hartmann, Mitglied der Geschäftsleitung und Leitung des Geschäftsfelds Förderung (li.) und Hanna Denecke, Leitung des Förderteams Exploration
Warum und wie engagiert sich die VolkswagenStiftung im Bereich der Grundlagenforschung? Ein Gespräch mit Henrike Hartmann, Leiterin des Geschäftsfelds Förderung, und Hanna Denecke, Leiterin des Förderteams Exploration.
Warum ist Grundlagenforschung wichtig?
Hanna Denecke: Grundlagenforschung bildet den Kern der Wissenschaft, sie setzt die Saat für alles, was danach kommt. Hier dürfen Forschende Fragen stellen, ohne sofort an eine Anwendung denken zu müssen. So definiert es auch die OECD: In der Grundlagenforschung darf man die Welt verstehen wollen, ohne sie zu verändern.
Henrike Hartmann: Ja, und das gilt für die Natur- und Lebenswissenschaften ebenso wie für die Sozial- und Geisteswissenschaften. Ohne Grundlagenforschung gelingen meiner Meinung nach keine wirklichen Durchbrüche. Nehmen wir die innovative Technologie CRISPR/Cas, die ja einen signifikanten Impact hat, für Forschung und Anwendung. Ursprünglich wurde sie im Rahmen von Grundlagenforschung zu Bakterien entwickelt. Wenn man verhindern möchte, dass die "Ideen-Pipeline" der Wissenschaft versiegt, aus der später Innovationen entstehen können, braucht man Grundlagenforschung.
Forschungsergebnisse kann man nicht vorhersehen.
Seit wann fördert die Stiftung Grundlagenforschung?
Henrike Hartmann: Die VolkswagenStiftung bringt bereits seit ihrer Gründung die Grundlagenforschung voran, sie ist Teil der DNA unseres Förderhandelns. Wir gewährleisten diesen Freiraum also schon über 60 Jahre lang - und werden das auch künftig verlässlich tun. Wissenschaftler:innen brauchen solche Optionenräume, in denen sie nicht auf die Anwendungsorientierung schauen müssen. Denn Forschungsergebnisse kann man nicht vorhersehen.
Wir sehen es als unsere Verantwortung an, immer wieder Raum für neue Ideen zu schaffen.
Hanna Denecke: In unserem Profilbereich "Exploration" wird unser Fokus auf Grundlagenforschung besonders deutlich, zum Beispiel in der Förderinitiative "Pioniervorhaben – Exploration des unbekannten Unbekannten" oder im Programm NEXT. Mit NEXT greifen wir Themen und Forschungsansätze mit hohem Erkenntnispotenzial auf, aktuell etwa Neuromorphic Computing. Damit wollen wir Impulse geben, etablierte Paradigmen zu überdenken und bislang unerschlossene bzw. sich neu entwickelnde Forschungsfelder aufbauen.
Neu ist unsere Ausschreibung zu "Night Science". Interdisziplinäre Tandems aus jeweils zwei Wissenschaftler:innen aus den Natur-, Lebens- oder Technikwissenschaften können hier Fördermittel beantragen, um ihre kreativen Fähigkeiten im Forschungskontext zu erweitern und unkonventionelle Ideen, Hypothesen oder Theorien zu entwickeln. Wir sehen den kreativen Prozess als unverzichtbaren Bestandteil der Grundlagenforschung. Er führt langfristig zum Erkenntnisfortschritt und zu Durchbrüchen, davon sind wir überzeugt.
Was macht die VolkswagenStiftung im Bereich Grundlagenforschung anders als andere Förderer?
Henrike Hartmann: Wer erkenntnis- bzw. neugiergetriebene Forschung fördern möchte, braucht einen langen Atem. Die Effekte greifen teils erst nach Jahrzehnten. Die Nobelpreise demonstrieren uns das jedes Jahr wieder aufs Neue, denn die Grundlagen dafür wurden oft schon vor langer Zeit gelegt und führen erst viele Jahre später zu einem Durchbruch. Wir sind als größte wissenschaftsfördernde private Stiftung und dank unserer Unabhängigkeit nicht auf schnelle Erfolge angewiesen.
Hanna Denecke: Wir sind sehr nah dran an unseren Wissenschaftler:innen, hören zu und erfahren so, was gebraucht wird. Wir orientieren uns eng am Bedarf der wissenschaftlichen Communities - ohne Zwänge bei der Themensetzung. Wir haben beispielsweise einige komplett themenoffene Förderangebote, das ist in der Förderlandschaft selten. In unseren "Pioniervorhaben" etwa kann man mit jeder Art von Idee einen Antrag stellen.
Nur wer scheitern darf, traut sich auch etwas.
Henrike Hartmann: Und wir gehen offen damit um, dass nicht alles gelingt. In vielen Teilen des Wissenschaftssystems sind Vorarbeiten und Publikationen die Voraussetzung für eine Förderung. Wir dagegen sagen in bestimmten Förderangeboten explizit, dass keine Vorarbeiten notwendig sind. Wir erwarten gegebenenfalls eine überzeugende Argumentation, wie mit überraschenden Wendungen in einem Projekt umgegangen wird. Das ist eine Einladung, wirklich neue Fragen zu stellen und den Blick zu weiten. Nur so entsteht das Innovative, Disruptive, das Neue.
Also gehören Misserfolge dazu?
Hanna Denecke: Nur wer scheitern darf, traut sich auch etwas. Wer echtes Forschungsneuland betritt, kann scheitern – eine Hypothese geht nicht auf oder eine These widerspricht der allgemeinen Sicht der Community. Dazu gehört Mut. Und da wollen wir unterstützen, denn diesen Mut braucht es, um voranzukommen.
Henrike Hartmann: Scheitern, oder genauer: die Falsifizierung einer Hypothese gehört unbedingt dazu. Besonders in der Grundlagenforschung. Erst die Erkenntnis, dass etwas nicht so funktioniert, wie in der Hypothese beschrieben, eröffnet neue Perspektiven. So entsteht Fortschritt.
Die Grundlagenforschung steht aktuell unter zunehmendem Legitimationsdruck…
Henrike Hartmann: Ja, denn insgesamt werden die Mittel knapper, und mehr denn je brauchen wir internationale Kooperationen. Die grundlegenden, kritischen, neugierigen Fragen, aus denen später Innovation entstehen kann, sind nicht an Nationen gebunden. Die geopolitischen Entwicklungen sollten keinesfalls zu Abschottung führen - das würde die Grundlagenforschung international schwächen und letztendlich Innovation blockieren. Als fördernde Stiftung sehen wir es als unsere Verantwortung an, immer wieder Raum für neue Ideen zu schaffen, damit Grundlagenforschung ihren berechtigten Platz und entsprechende Fördermittel bekommt.
Hanna Denecke: Neben finanziellen Einschränkungen sehen wir natürlich auch die politischen Veränderungen. In anderen Ländern kann man beobachten, dass die Wissenschaften unter politischen Druck geraten können. Umso wichtiger ist es, dass Grundlagenforschung einen geschützten, unantastbaren Raum bekommt.
Wir haben viel über Grundlagenforschung gesprochen. Wie blicken Sie auf angewandte Forschung?
Hanna Denecke: Wir sind breit aufgestellt, sowohl in der Bandbreite der Fachgebiete als auch bei der Zielsetzung, mit der wir in eine Förderung gehen. Die Stiftung ermöglicht es Wissenschaftler:innen, Neuland zu betreten und zu explorieren. Wir wollen explizit Forschung anstoßen, die durch Neugier und Erkenntnis getrieben ist – das ist die Aufgabe unseres Teams "Exploration". Das Team "Gesellschaftliche Transformationen" dagegen fokussiert sich auf transdisziplinäre, angewandte Forschung, die auf aktuelle gesellschaftliche Veränderungsprozesse reagiert. Und beim Team "Wissen über Wissen" steht das Wissenschaftssystem selbst im Mittelpunkt. Aber auch hier fördern wir sowohl angewandte als auch Grundlagenforschung, etwa mit "Momentum", einem Förderangebot für frischberufene Professor:innen.
Die Stiftung ermöglicht es Wissenschaftler:innen, Neuland zu betreten und zu explorieren.
Henrike Hartmann: Es gibt Wissenschaftsgebiete, da gehört Grundlagenforschung und angewandte Forschung unbedingt zusammen. Als wir 2020 die Ausschreibung "Antivirale Wirkstoffforschung" initiiert haben, betrieben viele Projekte ganz klar Grundlagenforschung zum Coronavirus. Es war mitten in der Pandemie – das Grundlagenwissen zum neuen Virus musste erst einmal erarbeitet werden. Trotzdem haben wir von Anfang an Anwendungsorientierung eingefordert: Eine Kooperation mit einer Pharmafirma musste bereits bei der Antragstellung mitgedacht werden, um im Erfolgsfall einen möglichst raschen und effizienten Transfer zu ermöglichen. Als unabhängige Stiftung können wir schnell genug reagieren und in aktuellen Situationen maßgeschneiderte, an die Situation angepasste Förderangebote entwickeln – das haben wir übrigens gerade auch wieder mit den "Transatlantischen Brückenprofessuren" bewiesen.