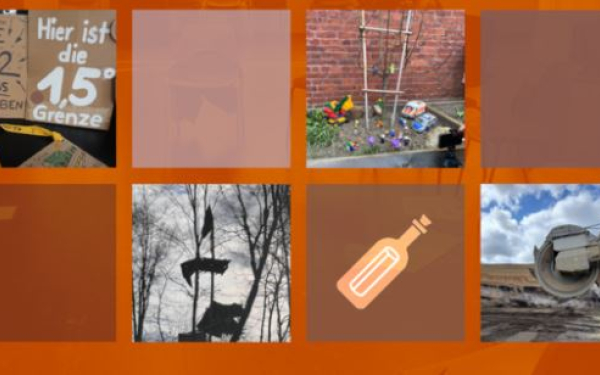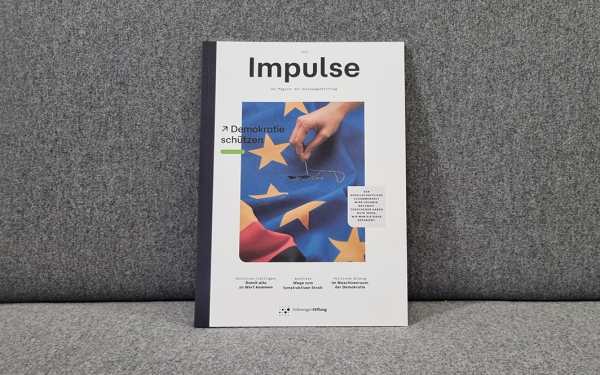Demokratie schützen: Wege zum konstruktiven Streit
#Demokratie
Daniel Chatard / laif
Konflikte sind häufig so festgefahren, dass kein konstruktiver Diskurs zwischen den Kontrahenten mehr möglich ist. Stattdessen werden via Social Media Feindbilder und Fake News genährt. Diese Nicht-Kommunikation gefährdet die Demokratie. Das Projekt "Testimonial Lab" erkundet neue Kommunikationsformen, die einen Dialog wieder möglich machen.
Klimawandel, Corona, das Gendern oder der Kampf um den Hambacher Forst im rheinischen Kohlerevier – das sind Themen, die polarisieren und über die sich trefflich streiten lässt. Streit ist eigentlich nichts Negatives. Er ist gut für eine Demokratie und hält sie durch Meinungsvielfalt lebendig.
[...] wir haben es immer häufiger mit Kommunikationsverweigerung und Kommunikationsabbruch zu tun.
Regelmäßige Nutzer:innen von Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook, X und Co. wissen indes: Wer sich dort einen Schlagabtausch über politische oder gesellschaftliche Themen liefert, ist nur selten an einem konstruktiven Diskurs interessiert. Da wird viel gehatet und geshitstormt, nach dem Motto: Du bist anderer Meinung? Dann bist du mein Feind – und warum du so denkst, wie du denkst, interessiert mich nicht. Es scheint vor allem darum zu gehen, wer als Sieger vom Platz geht, und nicht darum, einander zuzuhören und den anderen wirklich wahrzunehmen. Die Skepsis gegenüber demokratischen Prozessen wächst.
Das ist gefährlich, denn: "Diese Art des zugespitzten Streits kann die Bedingungen von Kommunikation überhaupt untergraben, mit dem Ergebnis, dass wir es immer häufiger mit Kommunikationsverweigerung und Kommunikationsabbruch zu tun haben", sagt Hans-Jörg Sigwart, Professor für Politische Wissenschaft an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. "Eine langfristige Folge ist, dass die Bereitschaft zur direkten Auseinandersetzung schwindet und eine grundsätzliche Skepsis gegenüber demokratischen Prozessen entsteht."
Sigwart und seinen Forscherkollegen Michel Dormal, ebenfalls habilitierter Politikwissenschaftler in Aachen, treibt deshalb die Frage um: Können es verschiedene Lager trotz gegensätzlicher Ansichten und verhärteter Fronten schaffen, einander zuzuhören? Und wie gelingt das? In ihrem im Herbst 2024 gestarteten transdisziplinären Projekt "Testimonial Lab – Exploring modes of articulation in deep societal conflict" erkunden Sigwart und Dormal in der Form eines Reallabors gemeinsam mit dem Soziologen Roger Häußling und der Soziologin Tabea Bongert sowie mit außeruniversitären Partner:innen neue Kommunikationsformen.
Spezielle Workshops – Testimonial Labs – sollen Konfliktsituationen zwischen Kontrahenten entschärfen helfen und ihnen jeweils ermöglichen, persönliche Botschaften zu formulieren, die ihnen wichtig sind. "Dabei wird Raum für ihre unterschiedlichen Erfahrungen geschaffen. Beide Seiten sollen sich erst einmal darauf konzentrieren, wie sie selbst die Situation erleben – und sie sollen erfahren, dass diese Botschaft tatsächlich gehört wird", erläutert Dormal. So könne dann auch die Bereitschaft entstehen, sich ernsthaft mit den Anliegen der "Gegenseite" auseinanderzusetzen.

Seit 2017 fotografiert Daniel Chatard (laif) im Rahmen seiner Arbeit „Niemandsland“ den Konflikt um den Kohleabbau in Nordrhein-Westfalen. Viele Jahre standen sich Polizei und Protestierende, die den Stopp der Förderung forderten, unversöhnlich gegenüber.
Nicht-Kommunikation in konstruktive Bahnen lenken
Dafür treffen sich die Gruppen getrennt voneinander und formulieren aus diesen Workshops heraus Botschaften für die jeweils andere Seite. "Die Idee ist, die Situation der Nicht-Kommunikation in ein Format zu überführen, in der diese Nicht-Kommunikation dann doch konstruktive Wirkungen entfaltet", so Sigwart.
Dieses Prinzip scheint gut zu funktionieren – das zeigt sich bereits vor dem Ende des Projekts. "Testimonial Lab" ist eines der Task-Force-Projekte, die die VolkswagenStiftung mit ihrer Initiative "Transformationswissen über Demokratien im Wandel" fördert. Sie alle bringen das Fachwissen von Wissenschaftler:innen und die praktische Expertise zivilgesellschaftlicher Akteur:innen zusammen. Im Mittelpunkt der Initiative stehen Fragen wie diese: "Wie können wir unsere liberalen demokratischen Strukturen schützen? Und welche Auswirkungen hat zivilgesellschaftliches Engagement auf die Transformation der Gesellschaft?"
Beispiel: Konflikt um den Hambacher Forst
Das Forscherteam der RWTH wählte für "Testimonial Lab" exemplarisch den langanhaltenden Konflikt um den rheinischen Kohletagebau aus: Klimaaktivist:innen und Energiearbeiter:innen – Beschäftigte von RWE Power – stehen auf entgegengesetzten Seiten. Die einen kämpfen seit vielen Jahren gegen die Rodung und für den Erhalt des Hambacher Forstes, leben teils in Baumhäusern vor Ort und positionieren sich damit scharf gegen die Braunkohleindustrie und deren Mitarbeitende. Zwar stoppte ein richterlicher Beschluss 2018 endgültig die Abholzung des großen Waldgebietes im Rhein-Erft-Kreis. Die Klima- und Naturschützer:innen sind aber weiterhin in Alarmbereitschaft und halten den Forst bis heute besetzt.
Allerdings ging und geht es in dem Konflikt nicht nur um den Hambacher Forst. Vielmehr setzten sich die Auseinandersetzungen 2022/23 unter anderem mit der Besetzung und Räumung des Dorfes Lützerath am Tagebau Garzweiler fort. Die andere Seite, die Beschäftigten, treibt dagegen die Befürchtung um, die gesellschaftliche Relevanz ihrer Arbeit werde nicht anerkannt und reale Sachprobleme würden oft falsch dargestellt. Ein direkter Dialog wäre zu Beginn wegen dieser schwierigen Ausgangslage gar nicht möglich gewesen.

Fotografie von Daniel Chatard: Um den Tagebau zu erweitern, wurden Wälder abgeholzt und ganze Dörfer zerstört und umgesiedelt.
Aus Sicht der Forschenden ist es ein Problem, "dass die etablierten politischen Institutionen es nicht schaffen, Konflikte wie jenen um den Hambacher Forst zu lösen und beide Seiten das Gefühl haben, dass ihre Erfahrungen und Beschwerden nicht angemessen anerkannt und artikuliert werden".
Botschaften an die andere Seite
Das greifen die Workshops, die zwischen Januar und April 2025 stattfanden, mit ihrer besonderen Form der getrennten Gruppen auf. Die Botschaften an die jeweils andere Gruppe waren etwa: Was macht uns Sorgen, wie haben wir den Disput um den Hambacher Forst bislang wahrgenommen? Wie erleben wir die Konfrontation mit euch Klimaaktivist:innen/ euch RWE-Mitarbeitenden? Wie stellen wir uns die Zukunft unserer Region vor? Die Form – ob als Text, als Bild, Tonaufnahme oder Video – war ihnen dabei freigestellt.
Herkömmliche partizipative Formate [...] stoßen an ihre Grenzen
Mit dieser übermittelten "Flaschenpost", wie Sigwart und Dormal es nennen, musste die Gegenseite sich anschließend inhaltlich beschäftigen. Bereits existierende Formen der Bürgerbeteiligung eignen sich hier weniger gut, sagen beide Forscher: "Herkömmliche partizipative Formate wie etwa Bürgerräte oder Mini-Publics stoßen an ihre Grenzen, denn sie setzen bereits einen minimalen Grad an Kommunikation und Austausch voraus. Der ist aber in verhärteten Konflikten meistens nicht gegeben." Als außeruniversitäre Partner wirken der Verein Regionale Resilienz, das MörgensLab des Theaters Aachen und der Deutsche Gewerkschaftsbund Aachen am Projekt mit.
"Der Verein bietet ein Netzwerk für eine ganze Reihe von zivilgesellschaftlichen Gruppen und Organisationen und war zum Beispiel hilfreich, als es darum ging, Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen für eine Teilnahme an unserem Projekt zu rekrutieren. Viele von ihnen waren nämlich anfangs recht skeptisch in Bezug auf unser Vorhaben", erläutert Michel Dormal.
Erfahrungen mit Playmobilfiguren nachstellen
Die Gewerkschaften und der RWE-Betriebsrat waren bei der Auswahl der Energiearbeiter:innen behilflich. Die Theaterschaffenden des MörgensLab wiederum kümmerten sich um den kreativen Rahmen der Workshops und gestalteten ihn inhaltlich mit. Das MörgensLab bringt Wissenschaftler:innen und Theatermacher:innen mit Aachener Bürger:innen für künstlerische Workshops und Science Slams zusammen und bot sich deshalb als idealer Partner an.
Im "Testimonial Lab" konnten die Teilnehmenden unter anderen in Rollenspielen oder mit Playmobilfiguren ihren persönlichen Erfahrungen und Erwartungen Ausdruck geben. Das kam bei den meisten gut an. Michel Dormal und Tabea Bongert beobachteten und dokumentierten die Workshops.
"Sowohl die RWE-Mitarbeitenden als auch die Klimaaktivist:innen sind als Gruppen jeweils durchaus heterogen", erläutert Dormal. "Etliche der RWE-Mitarbeitenden halten Umwelt- und Klimaschutz für sehr wichtig, sind aber nicht mit der als radikal empfundenen Art und Weise einverstanden, wie die Aktivist:innen ihre Ziele durchdrücken wollen. Andere finden, der Erhalt der Arbeitsplätze in der Region sei wichtiger als Klimaschutz." Die Aktivist:innen wiederum vereine zwar das Ziel, Umwelt und Klima schützen zu wollen, "sie rekrutieren sich aber aus unterschiedlichen Protestbewegungen – von Fridays for Future bis zur Anti-Atomkraft-Bewegung der 1980er-Jahre – und damit auch aus verschiedenen Generationen".

Fotografie von Daniel Chatard: Auch diese Kirche musste für die Erweiterung des Tagebaus weichen.
[Wir wollen herausfinden], wie sich [...] die Voraussetzungen für einen konstruktiven öffentlichen Diskurs wiederherstellen lassen.
Diese Heterogenität habe auch zu teils lebhaften Diskussionen innerhalb der beiden Gruppen geführt. "Das übergeordnete Ziel unserer empirischen Forschung ist, herauszufinden, wie durch dieses indirekte Kommunikationsformat eine Wechselseitigkeit etabliert werden kann und sich somit die Voraussetzungen für einen konstruktiven öffentlichen Diskurs wiederherstellen lassen – jenseits von Parlamenten und Parteien", sagt Hans-Jörg Sigwart.
Ein persönliches Treffen
Aus Sicht des "Testimonial Lab"-Teams ist das bereits gut gelungen. Schon nach dem dritten Workshop äußerten nämlich sowohl die Aktivist:innen als auch die RWE-Mitarbeitenden den Wunsch, sich nun auch persönlich treffen zu wollen, um sich auszutauschen.
"Das ist eine erfreuliche Entwicklung und war im Projekt eigentlich gar nicht so geplant", sagt Hans-Jörg Sigwart. "Für uns war klar, dass es am Ende vermutlich keine große Verbrüderung zwischen den beiden Gruppen geben wird. Wir sind bereits zufrieden, wenn wir die Sprachlosigkeit ein Stück weit überwinden helfen können." Mit seinen Kolleg:innen wird er auch das gewünschte persönliche Treffen noch begleiten und ist gespannt, wie es sich gestalten wird.
Sein Kollege Dormal ergänzt: "Es ist ein toller Erfolg, dass sich zwei Gruppen gefunden haben, die nicht nur bereit sind, Arbeit in eine ehrlich gemeinte Botschaft zu investieren, sondern sich nun auch noch bei einem persönlichen Treffen anhören wollen, was die andere Seite zu sagen hat." Damit, sagen beide Wissenschaftler, habe im Team niemand so schnell gerechnet. Das lasse hoffen, dass das "Testimonial Lab" auch in anderen gesellschaftlichen und politischen Konflikten gute Dienste leisten könne.