Wissenschaft und Politik im Spannungsfeld: Neue Forschungsprojekte erhalten Förderung
#Wissenschaftsforschung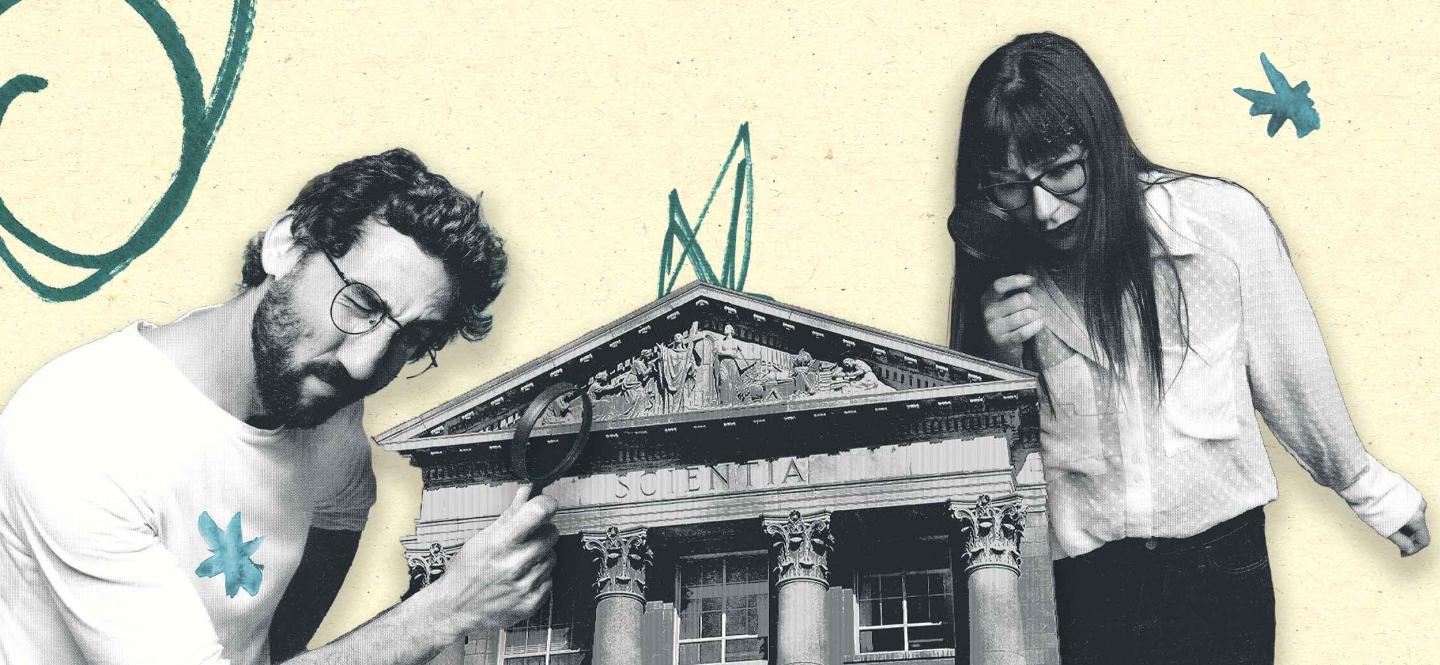
Jonas Willingstorfer für VolkswagenStiftung
Fünf neue Kooperationsprojekte widmen sich künftig der Frage, wie sich Wissenschaft in einer von politischen Anforderungen, globaler Vernetzung und digitalen Herausforderungen geprägten Welt entwickelt. Die VolkswagenStiftung stellt dafür rund 4,9 Mio. Euro im Rahmen ihrer Förderinitiative "Forschung über Wissenschaft" zur Verfügung.
Beteiligt sind unter anderem Teams in Berlin und Kaiserslautern. Die Projekte untersuchen zentrale Themen wie politische Einflussnahme auf wissenschaftliche Arbeit, den geopolitischen Wandel in der globalen Wissensproduktion sowie Fragen wissenschaftlicher Verlässlichkeit im digitalen Zeitalter.
"Mit der Initiative "Forschung über Wissenschaft" möchten wir dazu beitragen, dass besser nachvollziehbar wird, wie Wissenschaft funktioniert, sich verändert – und was das für unsere Gesellschaft bedeutet", sagt Dr. Johanna Brumberg von der VolkswagenStiftung. "Wir integrieren dabei auch die Erkenntnisse von Forschenden, die nicht aus der Wissenschaftsforschung kommen, aber sich mit wissenschaftlichen Arbeitsweisen beschäftigen. Der Austausch mit der Öffentlichkeit und offene Formen der Zusammenarbeit sind uns zudem sehr wichtig."
Alle geförderten Projekte im Überblick:
- Science under Pressure: Engaging with Science and Democracy in Hybrid Sites (SCIPRESS) (Dr. Cornelia Schendzielorz, Humboldt-Universität zu Berlin; Dr. Justo Serrano-Zamora, University of Barcelona, Spanien; Dr. Staffan Edling, Lund University, Schweden; rd. 1,1 Mio. Euro)
Dieses Projekt untersucht die zunehmende Verflechtung von Wissenschaft und Politik. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie politische Erwartungen die wissenschaftliche Arbeit beeinflussen. Analysiert werden unter anderem Denkfabriken, Forschungsinstitute und NGOs, die an der Schnittstelle beider Bereiche agieren. Ziel ist es, die Auswirkungen politischer Anforderungen auf die Arbeitsweise von Forschenden und das Zusammenspiel demokratischer und wissenschaftlicher Prinzipien besser zu verstehen. - China's Science Silk Road and the New Geopolitics of Knowledge Production (Prof. Dr. Anna Lisa Ahlers, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin; Prof. Dr. Han Cheng, National University of Singapore; Prof. Dr. Hang Zhou, Université Laval, Kanada; rd. 1 Mio. Euro)
Hier geht es um Chinas Bestrebungen, über seine "Belt and Road"-Initiative Einfluss auf globale Wissenschaftsnetzwerke zu nehmen. Im Zentrum steht das Programm "Science Silk Road". Die Forscher:innen analysieren, wie es Wissenschaftssysteme in verschiedenen Ländern verändert und welchen geopolitischen Einfluss Wissenschaft dadurch gewinnt. Methodisch setzt das Team auf Interviews, Dokumentenanalysen und Feldforschung. - Reproducibility Has Politics (PD Dr. Johannes Lenhard, Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau; Prof. Alexandre Hocquet, Université de Lorraine, Frankreich; rd. 500.000 Euro)
Rechnerbasierte Wissenschaften stehen oft vor dem Problem, Ergebnisse nicht exakt reproduzieren zu können – obwohl Computer eigentlich präzise sein sollten. Das Projekt geht der Frage nach, welche Rahmenbedingungen nötig sind, um verlässliche Resultate zu erzielen, und wer dafür verantwortlich ist. Im Fokus stehen die Disziplinen der computergestützten Chemie und Thermodynamik, aber auch philosophische und historische Perspektiven fließen ein. - Reforming Science: Investigating the Reflexivity & Reflectivity of (Non)Academic Actors Advocating for Science Reforms (Dr. Sheena F. Bartscherer, Humboldt-Universität zu Berlin; Prof. Dr. Jesper Schneider, University of Aarhus, Dänemark; 1,1 Mio. Euro)
Neue Communities, die als „Open Science“ bekannt sind, wollen die Wissenschaft verändern. Obwohl sie auf Forschung und Politik Einfluss nehmen, wissen wir wenig über sie. Dieses Projekt stellt drei Fragen: Erstens, welche Argumente verwenden Anhänger:innen und Kritiker:innen von Wissenschaftsreformen? Zweitens, wie sind diese Communities aufgebaut und entspricht ihre Wissensproduktion der von Forschungsgebieten oder wissenschaftlichen sozialen Bewegungen? Drittens, Wie unterscheiden sich aktuelle Wissenschaftsreformen von früheren grundlegenden Wissenschaftsreformen? Die Forschenden nutzen Netzwerkanalysen, Umfragen und Diskussionen, um die Argumente und Werte dieser Communities zu verstehen. Ein historischer Vergleich zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu früheren Reformen auf. - Looking Across Worlds for Environmental Justice: Interrogating Scientific Practices of Relating to Indigenous Knowledge (Dr. Annette Mehlhorn, Dr. Fausto César Quizhpe Gualán, Humboldt-Universität zu Berlin; Dr. Angus McNelly, King's College London, England; rd. 1,1 Mio. Euro)
Indigenes Wissen wird zunehmend als Schlüssel zum Verständnis der Umwelt- und Klimakrise angesehen. Trotzdem wissen wir wenig darüber, wie es in Forschungsprojekte eingebunden wird. Dieses Projekt untersucht, welche Ideen aus indigenen Kulturen weltweit verbreitet werden und welche nicht. Ziel ist es, die Bedingungen zu verbessern, unter denen vielseitiges Wissen entsteht. Die Forschenden aus Ecuador, Deutschland und Großbritannien kombinieren verschiedene Ansätze und nutzen kreative Methoden wie das "Theater der Unterdrückten" und Interviews. Zwei Fallstudien in Ecuador dienen als Ausgangspunkt, um herauszufinden, wie indigenes Wissen weltweit anerkannt wird und welchen Einfluss es auf Politik und Recht hat.
